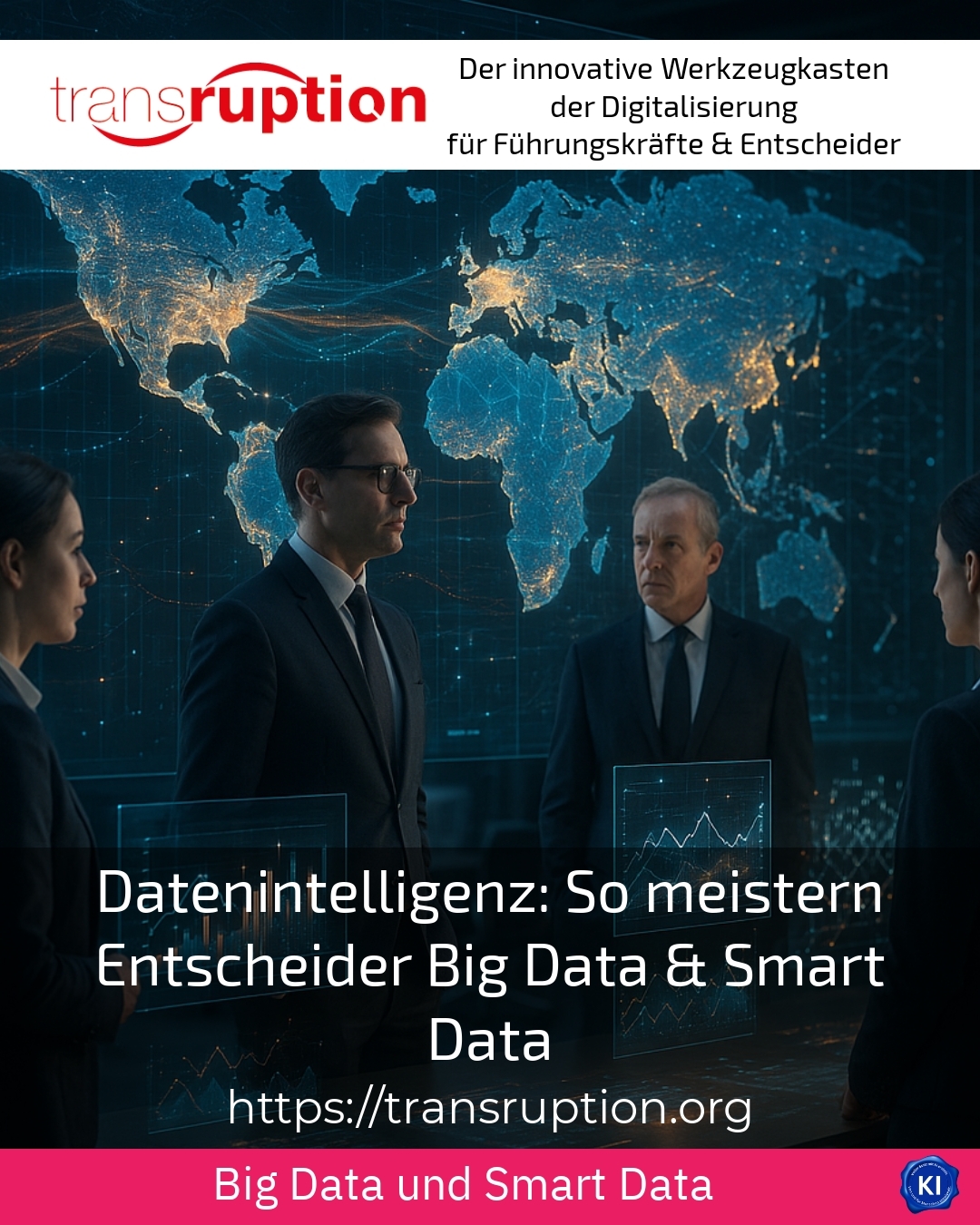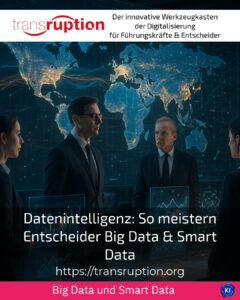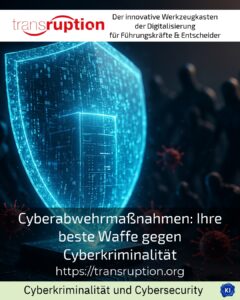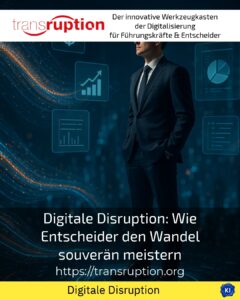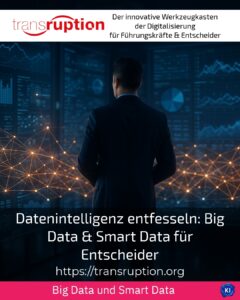Wissen ist das Fundament erfolgreicher Organisationen, und die Wissensweitergabe bildet das Rückgrat für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum. Immer mehr Unternehmen und Institutionen stehen vor der Herausforderung, Wissen strukturiert weiterzugeben, insbesondere vor dem Hintergrund von Personalwechseln, digitalem Wandel und agilen Arbeitsweisen. Wer Wissensweitergabe meistern will, findet mit dem transruptions-Coaching und der bewährten KIROI-Methode effiziente Wege, um Transferprozesse gezielt zu gestalten und nachhaltig zu sichern.
Was bedeutet Wissensweitergabe im Organisationskontext?
Wissensweitergabe bezeichnet den bewussten Prozess, Erfahrungen, Fähigkeiten und Informationen gezielt an andere Personen weiterzugeben. Häufig berichten Klient:innen von Problemen, wenn Experten ausscheiden oder Teams sich neu zusammenfinden. Die Wissensweitergabe hilft, implizites Know-how, also das aus der Erfahrung entstandene Wissen, sichtbar und nutzbar zu machen[1]. Ziel ist es, Wissensverluste zu vermeiden und die Kontinuität von Geschäftsprozessen sicherzustellen. Gleichzeitig stärkt eine gelebte Wissensweitergabe das Miteinander, fördert Lernkultur und motiviert Mitarbeitende, ihr Wissen zu teilen.
Erkenntnisse aus der Praxis: Typische Herausforderungen bei der Wissensweitergabe
Viele Unternehmen erleben ähnliche Stolpersteine beim Wissenstransfer. So bleibt wertvolles Erfahrungswissen oft ungenutzt, weil es nicht dokumentiert wird oder Mitarbeitende Hemmungen haben, ihr Wissen zu teilen. Beispielsweise verläuft die Einarbeitung neuer Kolleg:innen häufig unsystematisch und fachliches Wissen ist nur bei wenigen Personen zentral gebündelt. Auch führen digitale Tools allein selten zum gewünschten Erfolg, wenn nicht eine klare Struktur und die passende Kultur dahinterstehen[2].
Häufig melden Klient:innen, dass Wissenstransfer in der Praxis oft eine Nebenrolle spielt und nicht als strategisches Thema begriffen wird. Führungskräfte berichten, dass es an Zeit, Methodenkompetenz oder einer geeigneten Plattform für den Austausch fehlt. Unternehmen, die hier aktiv werden, setzen dagegen gezielt auf gezielte Weiterbildungen, interne Wissensdatenbanken und wertschätzende Austauschformate.
Beispiele für gelungene Wissensweitergabe
Ein Software-Unternehmen etablierte ein Patenprogramm für neue Mitarbeitende, bei dem erfahrene Kolleg:innen gezielt Einarbeitungsaufgaben übernehmen und regelmäßige Reflexionsgespräche stattfinden. So werden individuelle Fragen unmittelbar beantwortet und der Wissenstransfer wird personalisiert gestaltet[4]. Ein weiteres Beispiel: Eine Stadtverwaltung nutzt das Prinzip der Wissensstafette, bei der ausscheidende Mitarbeitende ihr Wissen an Nachfolger:innen in strukturierten, moderierten Gesprächen weitergeben – begleitet von einer Dokumentation, die für spätere Generationen erhalten bleibt[1]. Drittes Beispiel: In einer internationalen Beratung werden digitale Kollaborationsplattformen wie Slack oder Microsoft Teams eingesetzt, um Wissen dezentral abzulegen und so die Weitergabe über Standorte hinweg sicherzustellen[3].
BEST PRACTICE bei einem Kunden (Name verborgen aufgrund von NDA-Vertrag) und dann das Beispiel mit mindestens 50 Worten. Eine renommierte Kanzlei bat transruptions-Coaching, nachdem der Ausbildungsleiter nach 20 Jahren ausschied. Wir entwickelten gemeinsam eine mehrstufige Wissensstafette: Der Mitarbeiter erzählte sein Erfahrungswissen in mehreren offenen Gesprächsrunden, die vom HR-Team moderiert und von jungen Jurist:innen protokolliert wurden. So entstand eine umfassende Knowledge Base, die heute als zentrale Anlaufstelle für alle neuen Kolleg:innen dient. Zusätzlich werden seitdem regelmäßige Austauschformate im Team gelebt, um Wissen aktuell und abrufbar zu halten.
Die KIROI-Methode Schritt 1: Wissenslandkarten erstellen und Wissensträger:innen identifizieren
Der erste Schritt der KIROI-Methode richtet den Fokus auf die systematische Identifikation von Wissen und Wissensträger:innen. Denn wer Wissensweitergabe gestalten will, muss zunächst wissen, wer welches Wissen besitzt und wo es gebraucht wird. Wissenslandkarten helfen dabei, den Bestand an Wissen im Unternehmen sichtbar zu machen und Lücken frühzeitig zu erkennen[8]. Idealerweise werden diese Karten gemeinsam im Team entwickelt, weil so unterschiedliche Perspektiven einfließen und der Austausch gefördert wird.
Ein Beispiel: Ein Technologiehersteller führte interne Interviews mit allen Teams durch, um Spezialwissen zu dokumentieren. Die Ergebnisse wurden in einer digitalen Wissensdatenbank strukturiert abgelegt, sodass alle Mitarbeitenden gezielt auf Expertenwissen zugreifen können. Ein weiteres Beispiel: Ein mittelständisches Unternehmen nutzte eine Umfrage, um Wissensträger:innen zu nominieren und so eine Kultur der Anerkennung für Wissenstransfer zu schaffen[8]. Drittes Beispiel: Ein Bildungsinstitut erstellte interaktive Mindmaps, in denen Kompetenzbereiche und Verknüpfungen visuell dargestellt werden – das fördert die gemeinsame Verantwortung für Wissensweitergabe.
Konkrete Tipps für Führungskräfte
Führen Sie regelmäßige Wissenstage durch, bei denen Mitarbeitende ihr Fachwissen vorstellen. Schaffen Sie Anreize für Wissenstransfer, etwa durch öffentliche Anerkennung oder kleine Belohnungen. Setzen Sie auf eine Mischung aus persönlichen Gesprächen und digitalen Tools, um Wissensweitergabe effizient zu gestalten[2]. Ermöglichen Sie Zeit und Raum für den Austausch, denn unter Zeitdruck bleibt Wissen oft ungenutzt. Nutzen Sie die Stärken Ihrer Organisation, um maßgeschneiderte Formate zu entwickeln.
Wissensweitergabe als Führungsaufgabe begreifen
Wissensweitergabe ist keine Projektaufgabe, sondern ein kontinuierlicher Teil der Unternehmenskultur. Führungskräfte spielen dabei eine Schlüsselrolle, weil sie mit gutem Beispiel vorangehen und den Rahmen für Austausch schaffen müssen. Wer Wissensweitergabe als Führungsaufgabe versteht, investiert in Netzwerke, fördert Lernräume und schafft Anreize, Wissen zu teilen[5]. Häufig berichten Klient:innen, dass interne Champions, Coaches oder Wissensmanager:innen als Multiplikatoren helfen, Wissenstransfer in der Organisation zu verankern.
In einer Produktionsfirma übernehmen Führungskräfte selbst die Moderation von Übergabegesprächen und stellen so sicher, dass kein Wissen verloren geht. Ein Energiekonzern bildet interne Mentoren aus, die gezielt Nachwuchskräfte begleiten und so Wissenstransfer generationsübergreifend ermöglichen. In einer Kommunikationsagentur werden regelmäßig Lightning Talks veranstaltet, bei denen Mitarbeitende neue Erkenntnisse in kurzen Impulsvorträgen weitergeben und so Wissensweitergabe zur Selbstverständlichkeit wird.
Weiterführende Links aus dem obigen Text:
Leitfaden Wissenstransfer – Stadtverwaltung Wiesbaden [1]
Wissenstransfer Methoden: Strategien zur Wissenssicherung [2]
Wissensmanagement im Unternehmen: Methoden + Tipps [3]
Wissenstransfer Methoden – Wissen in Unternehmen nutzen [4]
Wissensmanagement Methoden: 7 Strategien für Führungskräfte [5]
Wissensstafette – Methoden zur Wissensbewahrung [6]
Wissenstransfer in Unternehmen – Ratgeber [8]
Meine Analyse
Wissensweitergabe ist ein zentraler Erfolgsfaktor für Organisationen jeder Größe. Wer dieses Thema strategisch angeht, vermeidet nicht nur Wissensverluste, sondern stärkt auch die Zusammenarbeit, Innovationskraft und Mitarbeiterzufriedenheit. Die KIROI-Methode strukturiert den Prozess vom ersten Schritt – der Identifikation von Wissen und Wissensträger:innen – bis zur nachhaltigen Sicherung des Know-hows. Praxisbeispiele zeigen, dass vor allem konkrete Formate, eine offene Kultur und engagierte Führungskräfte den Unterschied machen. Wer Wissensweitergabe als kontinuierliche Aufgabe versteht, profitiert dauerhaft vom Erfahrungsschatz seiner Teams und bleibt im Wettbewerb vorne.
Für mehr Informationen und bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt auf oder lesen Sie weitere Blog-Beiträge zum Thema Künstliche Intelligenz hier.